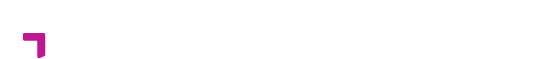Wenn dein Unternehmen Lager, Produktionsstandorte oder Kunden in mehreren EU-Ländern hat, kennst du das Problem: Die Zollanmeldungen müssen bislang in jedem Land separat gemacht werden.
Das bedeutet in der Praxis:
- Lokale Dienstleister in jedem Land
- Unterschiedliche Behörden & Prozesse
- Sprachbarrieren
- Hoher Koordinationsaufwand
- Fehleranfälligkeit
- Kosten, Zeit und Nerven
Der europäische Flickenteppich macht es Unternehmen unnötig schwer. Die Bewilligungsverfahren unterscheiden sich, und jedes EU-Mitgliedsland hat seine eigenen Anforderungen.
Das Verfahren der Centralised Customs Clearance (CCL) soll hier entgegenwirken und für mehr Effizienz sorgen.
Was ist Centralised Customs Clearance (CCL)?
Das Verfahren der Centralised Customs Clearance (CCL) oder zu Deutsch zentrale Zollabwicklung ermöglicht es Unternehmen, Einfuhr- und Ausfuhrformalitäten über ein einziges Zollamt im eigenen Land abzuwickeln – unabhängig davon, wo sich die Ware physisch in der EU befindet.
Das klingt zunächst technisch, hat aber enorme Vorteile:
- Einheitliche Prozesse & zentrale Kontrolle
- Weniger Schnittstellen, weniger Abstimmungsaufwand
- Klare Verantwortlichkeiten & gebündeltes Know-how
- Skalierbarkeit für internationale Lieferketten
- Schnellere Reaktionsfähigkeit bei Änderungen
Wichtig: CCL gilt ausschließlich innerhalb der EU-Mitgliedstaaten. Drittstaaten (wie z. B. Schweiz, UK oder Norwegen) sind davon nicht erfasst.
Reifegrad des CCL für Export und Import
Die zentrale Zollabwicklung im Export und Import befindet sich in Europa noch in einem Übergangsstadium hin zu voller Reife.
CCL im Export
Im Export ist die zentralisierte Exportabwicklung bereits ausgereift und praxistauglich etabliert. Unternehmen können über CCL bereits weitgehend zentral über einen Mitgliedstaat Ausfuhranmeldungen für Waren vornehmen, die in anderen EU-Ländern physisch ausgeführt werden.
CCL im Import
Im Import hingegen ist der Reifegrad der zentralen Zollabwicklung noch niedriger, da die vollständige Umsetzung von Systemen, Schnittstellen und rechtlichen Rahmenbedingungen noch läuft. Herausforderungen bestehen vor allem in der technischen Interoperabilität der IT-Systeme, der Harmonisierung von Datenanforderungen sowie der Zusammenarbeit zwischen nationalen Zollverwaltungen.
Welche Unternehmen können CCL nutzen?
Die zentrale Zollabwicklung ist nicht automatisch für jedes Unternehmen verfügbar. Um eine Bewilligung zu erhalten, müssen Unternehmen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die teilweise aufwändig und ressourcenintensiv sind.
AEO-Status Voraussetzung für CCL
Eine AEO-Zertifizierung (Authorised Economic Operator) ist die Grundlage für die Erlangung einer CCL-Bewilligung, das ein komplexes Prüfverfahren umfasst. Unternehmen müssen dabei ihre finanzielle Leistungsfähigkeit, interne Kontrollmechanismen, Compliance-Strukturen, Sicherheitsstandards entlang der gesamten Lieferkette sowie ihre Zuverlässigkeit über mehrere Jahre hinweg nachweisen.
Diese Anforderungen werden von den Zollbehörden detailliert überprüft – unter anderem durch Betriebsprüfungen vor Ort – und nach der Bewilligung in regelmäßigen Abständen erneut auditiert.
Für viele kleinere und mittelständische Unternehmen bedeutet das einen hohen personellen, organisatorischen und finanziellen Aufwand, da neben den Investitionen in IT-Systeme auch kontinuierliche Prozessdokumentation, interne Audits und enge Zusammenarbeit mit den Behörden erforderlich sind.
Technische Voraussetzungen für CCL
Die IT-Systeme müssen in der Lage sein, die Kommunikation mit Zollsystemen zentral zu steuern. D.h. die Zoll- und ERP-Systeme müssen entsprechend leistungsfähig sein, um nicht nur über zertifizierte Schnittstellen wie ATLAS (Deutschland) oder AES (Automated Export System, EU-weit) zu verfügen, sondern auch in der Lage sind, große Datenmengen in standardisierten Formaten (z. B. XML, EDIFACT) zuverlässig zu verarbeiten.
Diese Systeme müssen eine zentrale Steuerung der Zollprozesse ermöglichen – also die Bündelung von Meldungen aus verschiedenen EU-Staaten in einer einzigen Leitstelle – und dabei auch länderspezifische Besonderheiten berücksichtigen können.
Zusätzlich sind oft Integrationen in Supply-Chain-Management- und Compliance-Tools notwendig, um Stammdatenpflege, Dokumentenmanagement und Sanktionslistenprüfungen automatisiert einzubinden.
Standardsoftware oder Insellösungen stoßen hier schnell an Grenzen, da CCL hohe Anforderungen an Verfügbarkeit, Datensicherheit, Systemstabilität und Echtzeit-Kommunikation mit den Zollsystemen stellt.
Organisationale Voraussetzungen für CCL:
Auch die interne Organisation spielt eine entscheidende Rolle. Unternehmen müssen ihre Zollprozesse zentral steuern und koordinieren können. Das bedeutet: klare Zuständigkeiten, zentralisierte Abläufe und ein einheitliches Vorgehen über alle Standorte hinweg.
Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist die Kooperationsbereitschaft mit den Zollbehörden. Die Einführung und Nutzung von CCL erfordert eine enge Zusammenarbeit mit dem nationalen Hauptzollamt, das als zentrale Anlaufstelle fungiert.
Unsere Einschätzung:
Derzeit eignet sich CCL vor allem für größere Unternehmen, die ihre Zollprozesse zentral steuern und über eine komplexe EU-weite Lieferkette verfügen.
Für kleinere oder dezentral organisierte Unternehmen ist der Einstieg in CCL aktuell noch mit hohen Hürden verbunden, sowohl organisatorisch als auch technisch.
Wie sieht die zentrale Zollanmeldung in der Praxis aus?
In der Praxis läuft die zentrale Anmeldung so:
- Zentrale Erstellung der Zollanmeldung: Die Zollanmeldung wird wie gewohnt im IT-System des Unternehmens oder über einen beauftragten Dienstleister erstellt.
- Übermittlung an das Hauptzollamt: Die Anmeldung wird digital an das zuständige Hauptzollamt im Sitzland des Unternehmens übermittelt (z. B. Deutschland).
- Physische Gestellung der Waren: Die tatsächliche Gestellung erfolgt am Grenzzollamt des EU-Landes, in dem die Ware die Union verlässt oder betritt. Dort wird nur noch auf die zentrale Anmeldung verwiesen – mithilfe der EU-weit eindeutigen MRN (Movement Reference Number). Diese MRN fungiert wie ein digitales Aktenzeichen und verknüpft die zentral abgegebene Anmeldung mit der lokalen Abwicklung vor Ort.
- Kommunikation & Entscheidungen: Anders als bei der Zollanmeldung ohne CCL erfolgen Freigabe, Rückfragen, Prüfungen über das Hauptzollamt. Abstimmungen mit lokalen Behörden entfallen.
Das Ergebnis: Der lokale Aufwand reduziert sich erheblich, während Verantwortung und Datenhaltung in der Unternehmenszentrale gebündelt werden.
Herausforderungen & offene Fragen
So attraktiv das Modell der zentralen Zollabwicklung klingt, in der Praxis gibt es noch einige Hürden:
- Nicht überall harmonisierte Abläufe: Manche Mitgliedstaaten tun sich mit der Umsetzung schwer. Das neue Import‑System CCI (Centralised Clearance for Import) ist seit Juli 2024 in Betrieb, aber im ersten Schritt nur in acht EU‑Ländern verfügbar: Bulgarien, Estland, Spanien, Luxemburg, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien. Im Herbst 2024 kam Kroatien dazu, und kurz danach auch Italien.
- Manuelle Abläufe bremsen die Effizienz: In Deutschland wird bei der mitgliedsstaatenübergreifenden zentralen Zollabwicklung derzeit der Informationsaustausch zwischen der Ausfuhr‑ und Gestellungszollstelle noch manuell gesteuert. Beispielsweise werden Mitteilungen über Gestellung oder Verfahrensabschluss nicht automatisch übermittelt, sondern müssen von den Zollstellen in den jeweiligen Ländern explizit angestoßen werden.
- Technische Voraussetzungen sind nicht überall vorhanden: Zum Beispiel wurde Dänemark erst im März 2025 technisch auf den neuesten Stand gebracht und ist dann offiziell in das CCE‑Verfahren (Zentrale Zollabwicklung Ausfuhr) eingestiegen. Noch immer fehlen in einigen Ländern die notwendigen IT-Schnittstellen oder stabile Systemverbindungen. Nicht (oder noch nicht) integriert sind u. a. Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien und weitere, die noch technische Umsetzung oder Automatisierung umsetzen müssen.
Fazit
Für Unternehmen mit mehreren Standorten in Europa kann Centralised Customs Clearance ein echter Gamechanger sein: Weniger Bürokratie, weniger Fehler, mehr Transparenz.
Gerade im europäischen Flickenteppich aus unterschiedlichen Behörden, Prozessen und Sprachen ist die zentrale Zollabwicklung eine enorme Erleichterung.
Doch: Nicht jedes Unternehmen kann sofort einsteigen. Voraussetzung sind ein hoher Reifegrad der Organisation, AEO-Status und technische Kompetenz.
Wer sich frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzt und Pilotprojekte wagt, kann sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern:
- Zeit- und Kostenersparnis: Wer Prozesse frühzeitig zentralisiert, reduziert redundante Zollanmeldungen, spart Bearbeitungszeit und vermeidet Mehraufwand durch parallele Abläufe in mehreren Ländern. Weniger Schnittstellen und Fehler führen direkt zu geringeren Kosten.
- Reibungslosere Abläufe in der Lieferkette: Schnellere Abfertigung bedeutet weniger Verzögerungen an den Grenzen und damit eine stabilere, verlässlichere Supply Chain.
- Attraktivität für Geschäftspartner: Kunden und Lieferanten bevorzugen Unternehmen, die ihre Zollabwicklung effizient und transparent steuern können. Das signalisiert Professionalität, Compliance und Risikominimierung – ein echter Pluspunkt in Ausschreibungen oder langfristigen Partnerschaften.
- Früher Lerneffekt: Pilotnutzer bauen intern Know-how auf, das später schwer einzuholen ist. Sobald die Einfuhr-CCL EU-weit etabliert ist, können diese Unternehmen mit eingespielten Prozessen sofort skalieren, während Wettbewerber noch an der Umstellung arbeiten.
Es geht sowohl um direkte Effizienzgewinne (Zeit/Geld) als auch um strategische Vorteile im Marktauftritt – insbesondere, wenn die EU in den kommenden Jahren die Einfuhr-CCL vollumfänglich etabliert.