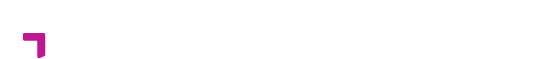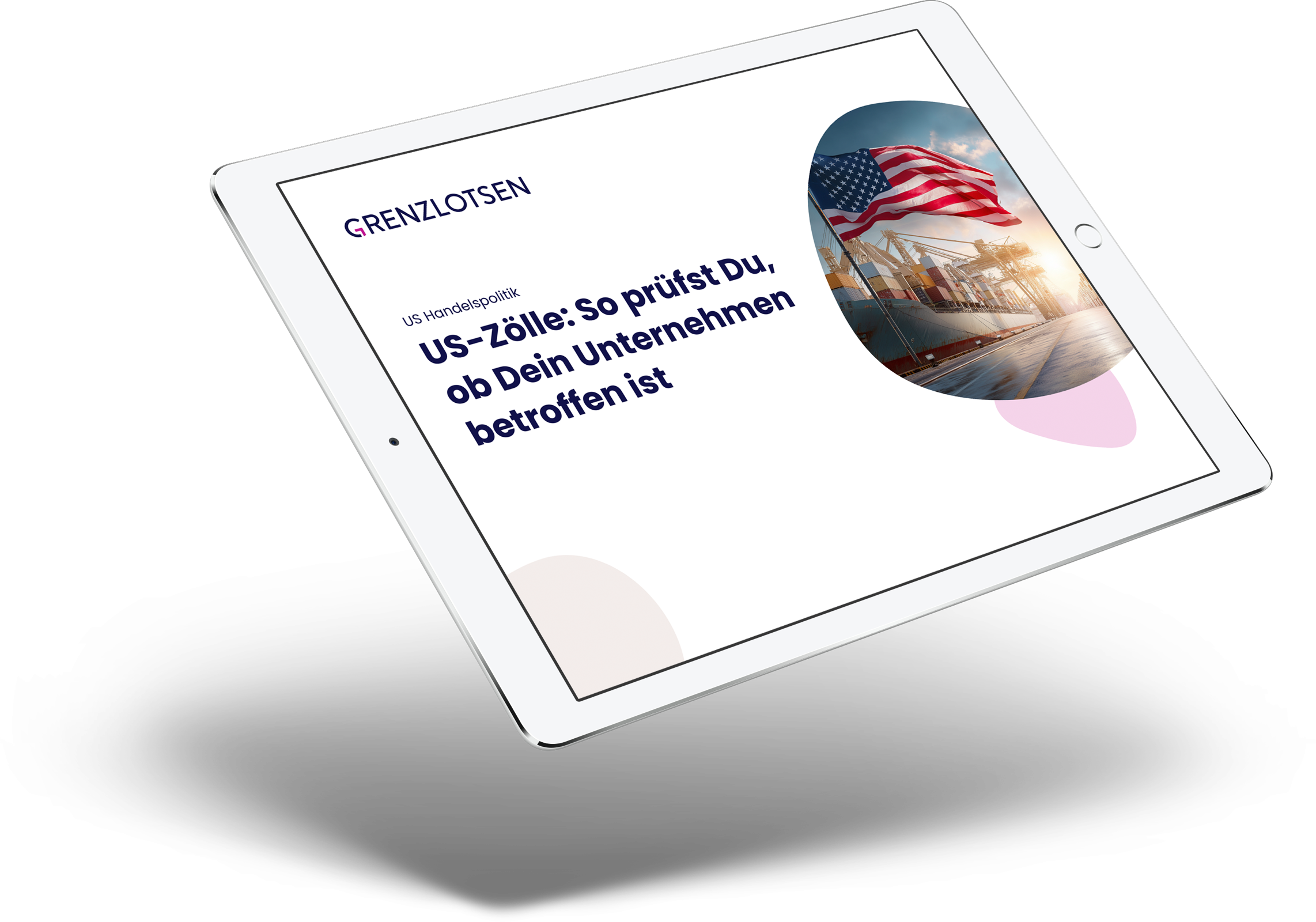Ursprung des Konflikts: Aus US-Perspektive geht es um „Fairness“
Der aktuelle Handelskonflikt zwischen den USA und ihren Partnerländern basiert auf der Einschätzung der Trump-Administration, dass viele Handelsbeziehungen „unfair“ seien. Ziel war (und ist) es, die Handelsbilanz der USA zu verbessern und das mit Zöllen und Handelshemmnissen, die oft kurzfristig eingeführt und politisch motiviert sind. Eine konsistente industriepolitische Linie? Fehlanzeige.
Was aktuell gilt: Ein Überblick über die wichtigsten Zollmaßnahmen
Reciprocal Tariffs (reziproke Zölle)
- Zölle in Höhe derer, die das jeweilige Partnerland gegenüber den USA erhebt
- Klingt simpel, führt in der Praxis aber zu einem undurchsichtigen Flickenteppich
IEEPA-Tariffs
- Verhängt auf Basis eines „nationalen Notstands“
- Bis zu 25 % auf Waren aus Kanada und Mexiko, 20 % auf China
- Ursprünglich begründet mit der Bekämpfung des Drogenschmuggels
Section 232 Tariffs
- Seit 2018 gelten Zusatzabgaben auf Aluminium und Stahl
- Mittlerweile reicht schon ein Aluminiumanteil von 0,03 %, um bis zu 50 % Zoll auszulösen
Keine einheitlichen Regeln - Ein Flickenteppich aus Ausnahmen
Was sich in den vergangenen Monaten deutlich zeigt: Es gibt kaum noch verbindliche Standards. Die meisten Maßnahmen basieren auf kurzfristigen Entscheidungen – ergänzt durch Sonderregelungen, Ausnahmen oder temporäre Modelle. Viele dieser Vorgaben wurden nach kurzer Zeit schon wieder angepasst, ergänzt oder revidiert.
Das Ergebnis: ein hochkomplexes, unübersichtliches System, das Unternehmen kaum noch ohne spezialisierte Unterstützung bewältigen können. Wer hier sicher durchkommen will, braucht einen Customs Broker, der nicht nur das US-Zollrecht kennt, sondern auch tagesaktuell über Änderungen informiert ist und operative Konsequenzen richtig einordnet.
Fehlende Rückerstattungsmöglichkeiten und überforderte Administration
Ein weiterer Knackpunkt: In den USA gibt es bislang keine etablierten Verfahren, um zu viel oder falsch gezahlte Zölle zurückzufordern. Was in Europa oft über Erstattungs- oder Änderungsverfahren möglich ist, fehlt in den USA weitgehend. Selbst wenn ein Fehler später erkannt wird und eine Rückzahlung ist meist nicht vorgesehen.
Gleichzeitig ist auch die US-Zollbehörde CBP stark gefordert. Die Vielzahl kurzfristiger und komplexer Regelungen lässt sich kaum noch in die Systeme integrieren, ohne dass es zu Verzögerungen oder Unklarheiten kommt. Selbst erfahrene US-Broker berichten, dass sie mit der Geschwindigkeit der Anpassungen kaum Schritt halten können.
Kurz gesagt: Auch auf US-Seite herrscht vielerorts Überforderung. Und das spüren letztlich die Unternehmen in Form von Unsicherheiten, Rückfragen, Verzögerungen und Risiken.
Operative Auswirkungen: Wenn die Theorie nicht zur Praxis passt
Diese Gemengelage hat dazu geführt, dass fehlerhafte Zollberechnungen und Überzahlungen im Tagesgeschäft zur Normalität geworden sind. Da Rückerstattungen so gut wie nicht vorgesehen sind, bleiben viele Unternehmen auf den Kosten dieser Fehler sitzen.
Hinzu kommt: Die Anwendung der Zölle folgt einer komplexen Hierarchie. Die Vorgaben kommen von der CBP, die Verantwortung für die korrekte Umsetzung liegt aber bei den Zollagenten und Importeuren. Das führt zu einer Vielzahl von Anwendungsfehlern, insbesondere, wenn das Fachwissen fehlt oder die Prozesse nicht sauber abgestimmt sind.
Erfahrene Customs Broker können hier oft entscheidend helfen. Aber auch sie brauchen ausreichend Informationen vom Unternehmen, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
Juristische Unsicherheit und der Blick nach vorn
Hinzu kommt eine weitere Unwägbarkeit: Die rechtliche Grundlage vieler Maßnahmen ist aktuell selbst Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. Zwei US-Bundesgerichte haben Ende Mai entschieden, dass Präsident Trump möglicherweise nicht berechtigt war, auf Basis des IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) so weitreichende Zölle zu verhängen.
Klar ist: Solange diese Verfahren nicht abschließend geklärt sind, bleiben die Zölle bestehen und mit ihnen die Unsicherheit. Parallel endet am 9. Juli die aktuelle Aussetzung der wechselseitigen Strafzölle. Sollte diese nicht verlängert werden, könnten die pauschalen 10% wieder durch differenzierte, länderspezifische Zollsätze ersetzt werden – abhängig vom Stand der bilateralen Verhandlungen.
Für Unternehmen heißt das: Das regulatorische Umfeld bleibt volatil mit potenziell erheblichen Folgen für Preisgestaltung, Lieferfähigkeit und rechtliche Risiken.
Handlungsempfehlungen für Importeure
Was also tun in diesem Umfeld? Unsere Empfehlung: Unternehmen sollten ihre Importprozesse jetzt strategisch unter die Lupe nehmen. Ein reaktives Vorgehen reicht nicht mehr. Es braucht klare Strukturen und fundierte Entscheidungsgrundlagen. Besonders hilfreich sind folgende Maßnahmen:
- Warenströme analysieren: Nutze ACE-Daten, um Transparenz über Deine gesamten US-Importe zu gewinnen, inklusive Warengruppen, Zolltarifnummern und Partnerländer.
- Spezialregelungen kennen: Gerade bei Aluminium- oder Stahlerzeugnissen gelten Sonderregelungen. Prüfe, ob Deine Produkte betroffen sind. Selbst minimale Materialanteile können zu hohen Abgaben führen.
- CSMS-Meldungen aktiv verfolgen: Der Cargo Systems Messaging Service (CSMS) der CBP informiert regelmäßig über operative Änderungen und Systemanpassungen.
- Ursprungsnachweise im Blick behalten: Differenzierte Zollsätze machen die Herkunftsangabe zu einem kritischen Faktor. Unvollständige oder fehlerhafte Ursprungsdokumente können teuer werden.
- Auditsysteme aufbauen: Eine strukturierte Kontrolle Deiner Zollanmeldungen hilft, Fehler frühzeitig zu erkennen und stärkt die Compliance.
- PSC-Verfahren nutzen: Das Post Summary Correction-Verfahren erlaubt es, Fehler in der Zollanmeldung nachträglich zu korrigieren innerhalb bestimmter Fristen.
- Entscheidungsfähigkeit stärken: Je besser Du Deine Optionen kennst, desto gezielter kannst Du reagieren und Risiken frühzeitig managen.
Weitere Maßnahmen der US-Regierung bereits in der Pipeline
Die Entwicklungen sind noch nicht zu Ende. Im Gegenteil: Die US-Regierung prüft derzeit weitere Zollerhöhungen in sensiblen Bereichen. Im Gespräch sind u. a.:
- 200% Zoll auf Wein, Champagner und Spirituosen aus Europa
- 25% Zoll auf Importe aus Ländern, die Öl oder Gas aus Venezuela beziehen
- 100% Zoll auf ausländische Filmproduktionen
- Neue Maßnahmen auf Holz, Bauholz und Kupfer
Diese Ankündigungen zeigen: Auch Importeure aus Deutschland und der EU müssen sich auf weitere Handelsbarrieren einstellen, selbst wenn sie nicht direkt in die USA exportieren, sondern auf globale Lieferketten angewiesen sind.
Informationsquellen, die Du im Blick behalten solltest
Wer jetzt gut informiert bleiben will, sollte regelmäßig die folgenden Quellen prüfen:
Fazit
Das aktuelle Zollumfeld in den USA ist geprägt von kurzfristigen Maßnahmen, fehlender rechtlicher Klarheit und einem kaum durchschaubaren Regelwerk. Für Importunternehmen heißt das: Wer nicht strategisch und mit klarem Prozess agiert, läuft Gefahr, in diesem Chaos unterzugehen.
Mit einer fundierten Analyse der eigenen Warenströme, einem erfahrenen Customs Broker an der Seite und einem wachsamen Auge auf politische Entwicklungen lassen sich viele Risiken abfedern und sogar Chancen identifizieren. Denn wer vorbereitet ist, kann auch in unübersichtlichen Märkten handlungsfähig bleiben.